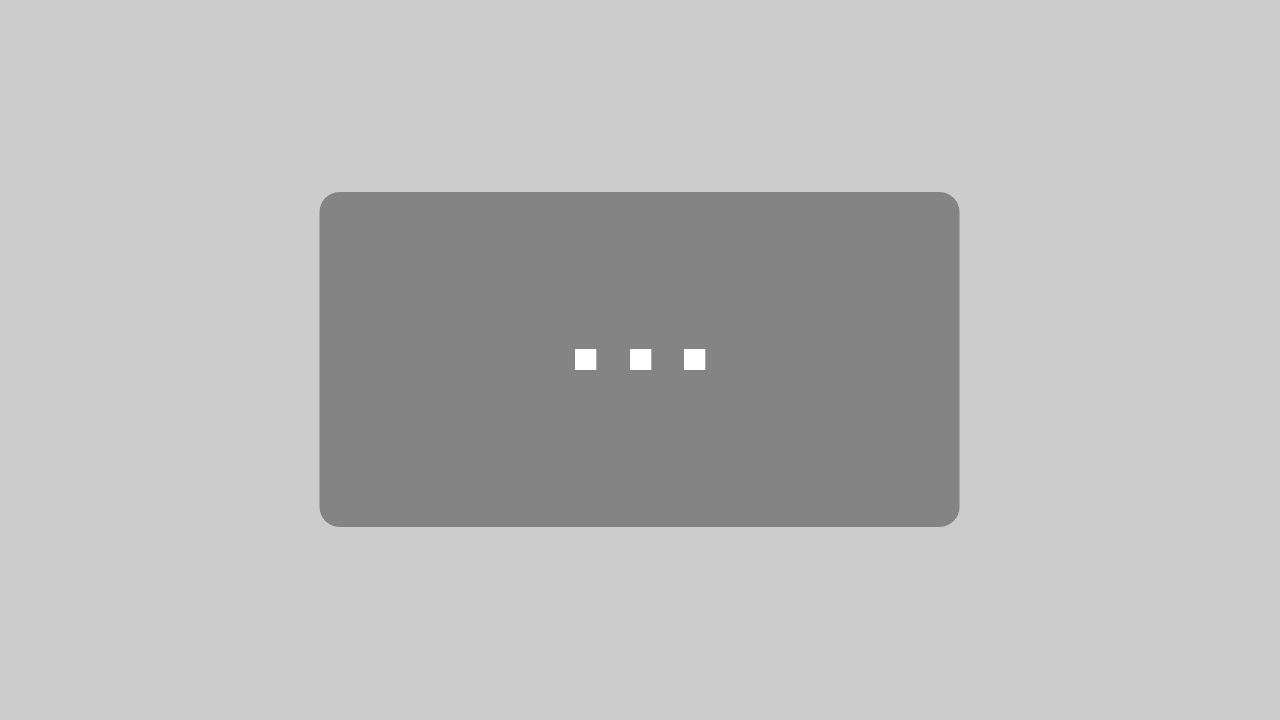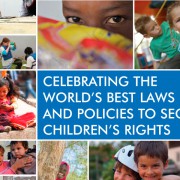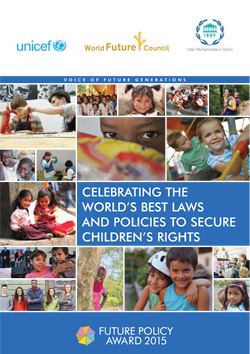Bessere Lebensbedingungen: Äthiopien gewinnt internationalen Preis für erfolgreiche Maßnahmen gegen Landverödung
Hamburg / Bonn / Ordos, 22. August 2017: Erosion verringern, Lebensqualität verbessern: die äthiopische Tigray-Region zeigt, dass dies möglich ist. Darum wird sie vom World Future Council mit dem Future Policy Award (FPA) in Gold ausgezeichnet, der dieses Jahr die besten Maßnahmen und Politiken ehrt, die erfolgreich Desertifikation und Landverödung bekämpfen. Die Tigray-Region setzte sich gegen 26 andere Nominierungen aus aller Welt durch. Mit dem Gesetz werden auf einzigartige Weise gemeinschaftliches Handeln, Freiwilligenarbeit und Einbindung der Jugend kombiniert. Durch die Einführung des Gesetzes wird verödetes Land wieder bewohnbar gemacht.

Photo by TerrAfrica Partnership at NEPAD Agency
Zwei Silber Awards werden vergeben an:
- Brasilien: Das brasilianische Zisternen-Programm gibt Millionen Menschen in den ärmsten Regionen Brasiliens die Chance auf Selbstbestimmung
- China: Durch das chinesische Gesetz zur Prävention und Kontrolle von Desertifikation wurde in den letzten 15 Jahren der Trend der zunehmenden Wüstenbildung umgekehrt und Millionen von Menschen aus der Armut befreit
Der Vision Award geht an die internationale „4 per 1000“ Initiative, ein einmaliges Konzept für den Klimaschutz: Jährlich soll der im Ackerboden gebundene Kohlenstoff um 0,4 Prozent erhöht werden. So können 1,2 Milliarden Tonnen Kohlenstoff pro Jahr gespeichert und der Klimawandel aufgehalten werden.
Drei Bronze Awards gehen dieses Jahr an:
- Australien: In Australien übernehmen Indigene erfolgreich den Schutz der Trockengebiete vor Landverödung
- Jordanien: Jordanien integrierte die im Nahen Osten am weitesten verbreitete Hirten-Tradition „Hima“ in seine neue Weidelandstrategie und entwickelt daraus innovative Maßnahmen gegen Desertifikation
- Niger: Der westafrikanische Staat verbindet in seiner 3N Initiative den Kampf gegen Landverödung mit der Herstellung von Nahrungssicherheit
Weitere Informationen zu den Gewinner-Gesetzen finden Sie hier
Stellungnahmen des World Future Council und der UNCCD
Monique Barbut, Exekutivsekretärin, Sekretariat des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Desertifikation (UNCCD)
“Trockengebiete bedecken fast 40% der Landmasse der Erde und wachsen durch den Klimawandel stetig an. Millionen von Menschen sind dadurch von Hunger und Armut bedroht – doch die Weltgemeinschaft nimmt dies kaum zur Kenntnis. Der Future Policy Award 2017 wirft ein Schlaglicht auf eine unterschätzte Naturkatastrophe, die sich schleichend ihren Weg bahnt – und auf effektive Lösungen. Die sieben Preisträger sind alle selbst von Desertifikation betroffen und zeigen großes Umweltbewusstsein und politische Handlungsfähigkeit.“
Alexandra Wandel, Direktorin und Stellv. Vorstandvorsitzende des World Future Council (WFC)
„Durch Wüstenbildung verlieren Millionen von Menschen ihre Heimat. Mit der äthiopischen Tigray-Region als Gewinnerin des Future Policy Awards steht fest, dass wirksame Lösungen nicht von außen kommen müssen: Fluchtursachen können am Ort des Geschehens erfolgreich angegangen werden. Eine kleine Region in einem vom Klimawandel bedrohten, ostafrikanischen Land hat Wege gefunden, eine globale Herausforderung effektiv anzugehen – ich sehe dies als ermutigende Botschaft.“
Zum Hintergrund
Im vergangenen Jahrhundert sind durch Dürren mehr Menschen ums Leben gekommen als durch jede andere wetterbedingte Katastrophe. Desertifikation wird daher heute als eine der größten Herausforderungen der Menschheit gesehen. Trockengebiete sind äußerst anfällig für Überbeanspruchung und Klimaveränderungen, Dürren kommen inzwischen aufgrund des Klimawandels immer häufiger vor, was den Effekt noch verstärkt. Diese Regionen gehören zu den konfliktreichsten Gebieten der Erde.
Die Gesetze, die vom FPA ausgezeichnet werden, unterstützen vorbildlich das Ziel für nachhaltige Entwicklung (SDG) 15.3 der Vereinten Nationen, der Kampf gegen die Desertifikation und die Wiederherstellung der durch Wüstenbildung, Dürren und Überflutungen degradierten Flächen.
Der Future Policy Award (FPA) zeichnet als einziger internationaler Preis effektive Gesetze aus, die die Lebensbedingungen für Menschen weltweit verbessern. Ziel des Preises ist es, die öffentliche Aufmerksamkeit auf nachhaltige Gesetze und Maßnahmen zu lenken. Die Evaluation der Gesetze findet anhand der “Sieben Prinzipien für zukunftsgerechte Gesetzgebung“ statt. Daher werden Gesetze besonders positiv bewertet, die nicht nur die nachhaltige Nutzung von Ressourcen fördern, sondern darüber hinaus Gleichberechtigung, Armutsbekämpfung, Teilhabe und friedliche Konfliktlösung in Angriff nehmen.
Die Gewinner des Future Policy Awards werden im Rahmen der 13. Vertragsstaatenkonferenz (Conference of the Parties, COP) der UNCCD in Ordos (China) im September 2017 geehrt.
Weitere Informationen zum diesjährigen Future Policy Award finden Sie hier
Read this Press Release in other languages
Medienkontakt
Miriam Petersen
Media & Communications Manager
Tel: +49 40 307 09 14 19
miriam.petersen@worldfuturecouncil.org
Wagaki Wischenewsjki
Public Information and Media Officer
United Nations Convention to Combat Desertification
Tel: +49 228 815 2820
wwischnewski@unccd.int
Der World Future Council Der World Future Council stellt die Interessen zukünftiger Generationen ins Zentrum von Politikgestaltung. Der Rat besteht aus 50 internationalen Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur, die in ihrem Themenbereich bereits Herausragendes geleistet haben. Er setzt sich für gesetzliche Rahmenbedingungen ein, die heutigen wie zukünftigen Generationen das Leben in einer gerechten und ökologisch intakten Welt ermöglichen. Die Hauptansprechpartner hierfür sind politische Entscheidungsträger und Parlamentarier, aber auch Partner aus der Zivilgesellschaft, Wirtschaft und internationalen Organisationen. Für eine nachhaltige, gerechte und friedliche Zukunft, in der universelle Rechte respektiert werden, erforschen, identifizieren und verbreitet der World Future Council die besten globalen politischen Lösungen.
UNCCD – Sekretariat des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Desertifikation Das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) ist der einzige, rechtsverbindliche internationale Vertrag, der sich mit Landfragen auseinandersetzt. Das Abkommen unterstützt verantwortungsbewusste und gute Landpflege. Die 196 Vertragspartner verpflichten sich, die Konvention partnerschaftlich umzusetzen und die Nachhaltigkeitsziele der UN zu verwirklichen. Am Ende steht das Ziel, unser Land vor Überbeanspruchung und Dürren zu schützen, so dass es uns weiter mit Nahrung, Wasser und Energie versorgen kann. Durch die nachhaltige Bewirtschaftung von Land und das Streben nach Landdegradations-Neutralität jetzt und in der Zukunft, sollen die Folgen des Klimawandels abgemildert und Konflikte um natürliche Ressourcen verhindert werden, damit unsere Gesellschaften sich gut entwickeln können.

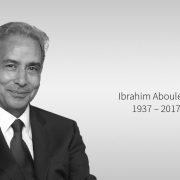









 Ohne Zweifel ist die Grundschule Crellin ein herausragendes Beispiel dafür, die Natur als Lehrmittel für Umweltprobleme zu nutzen – aber es ist keineswegs untypisch. Marylands Umweltbildungs-Standards animieren nicht nur, sie geben auch die Verantwortung an alle Beteiligten weiter, indem diese Art des Lernens durch neue, lokale Aktionsgruppen und Projekte, die sich dem Umweltschutz verschrieben haben, weiter gefördert wird. In einer High School in Baltimore beschrieben LehrerInnen, wie sie Umweltbildung in ihre Unterrichtsstunden einbauen – zum Beispiel wird im Kunstunterricht nur mit wiederverwertbaren Materialien gearbeitet und historische Fälle von Umweltverschmutzungen im Unterricht thematisiert.
Ohne Zweifel ist die Grundschule Crellin ein herausragendes Beispiel dafür, die Natur als Lehrmittel für Umweltprobleme zu nutzen – aber es ist keineswegs untypisch. Marylands Umweltbildungs-Standards animieren nicht nur, sie geben auch die Verantwortung an alle Beteiligten weiter, indem diese Art des Lernens durch neue, lokale Aktionsgruppen und Projekte, die sich dem Umweltschutz verschrieben haben, weiter gefördert wird. In einer High School in Baltimore beschrieben LehrerInnen, wie sie Umweltbildung in ihre Unterrichtsstunden einbauen – zum Beispiel wird im Kunstunterricht nur mit wiederverwertbaren Materialien gearbeitet und historische Fälle von Umweltverschmutzungen im Unterricht thematisiert.